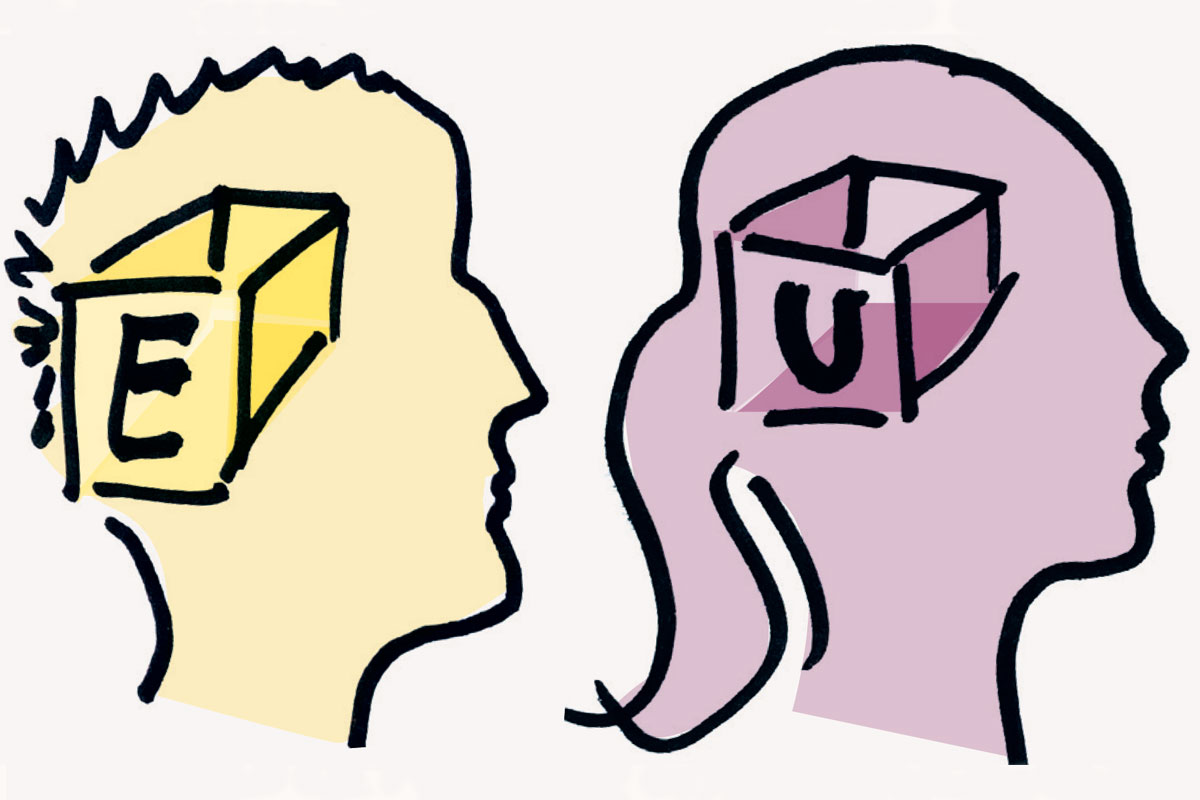
Schubladen. Sie sind meist hübsch anzusehen und vermitteln ein beruhigendes Gefühl von Ordnung und Klarheit. Ohne ihre ordnungsstiftende Existenz wäre es um die Effizienz der Menschheit schlecht bestellt. Sie finden sich überall. In der Küche, im Wollgeschäft, im Anwaltsbüro. Und in der Buchhandlung. Hier zwar nur selten als physisches Objekt aus Holz, Metall und ausgeklügelter Mechanik, dafür aber umso mehr in den Köpfen derjenigen, die die Bücher in den Handel bringen. Jedes Buch, das angeliefert wird, muss darin einsortierbar sein.
Auf den beiden größten imaginären Schubladen prangen die Buchstaben E und U: U für Unterhaltung und E für Ernst. Und die prallvolle Unterhaltungs-Lade braucht natürlich weitere Unterschubladen, damit der Inhalt übersichtlich bleibt.
Die Buchhandlung und ihre Ordnung
So kommen Liebesromane auf den Tisch gleich vorne links am Eingang, direkt daneben die Thriller und ein wenig weiter rechts die Krimis. Ganz hinten stehen die politischen Sachbücher; Bestseller, natürlich gut sichtbar mit Banderolen, befinden sich möglichst auch im Schaufenster. Und die sogenannte E-Literatur mit den schlichten, nüchternen Covern und klugen Gedanken hoch angesehener Literaten liegt fein säuberlich getrennt vom profanen Rest.
So zumindest sieht es in meiner Stammfiliale einer großen Buchhandelskette aus.
Eine Ordnung, die ich als Leserin kaum je infrage gestellt habe. Wie sonst sollte ich wissen, in welchem Regal, auf welchem Tisch die Lektüre liegt, die gerade zu meiner Gestimmtheit passt? Sinnvoll also. Wobei ich dann wiederum allzu häufig feststellen muss, dass zwischen den Deckeln dieser so wunderbar sortierten U-Romane nur Erwartbares steckt. Schnittmustergeschichten; zwar handwerklich gut gemacht, selten aber wirklich überraschend anders als die restlichen Romane aus der gewählten Schublade.
Kein Platz für Experimente?
Ich möchte aber unterhalten werden. Deswegen mache ich um die E-Tische oftmals einen Bogen. Es ist schwer, durch bloßes Stöbern auf den Büchertischen dieses überraschend Andere zu finden, das mich persönlich so reizt. Könnte es sein, dass aus der Orientierungshilfe der Steuermann für den behäbigen Ozeanriesen namens „Buchmarkt“ geworden ist, der nahezu alle Geschichten über Bord gehen lässt, die sich der heiligen Schubladenordnung nicht beugen wollen?
Das ist eine Frage, die uns als Autorinnen und Autoren zwangsläufig beschäftigen muss. Vor allem, wenn wir Romane schreiben, die vielleicht immer ein wenig am E kratzen, aber doch eigentlich unterhalten wollen, wenn auch mit Anspruch.
Und welches Genre bedienst du?
Ich weiß noch, wie ich gleich am ersten Abend meines allerersten Autorenseminars gefragt wurde, welches Genre ich denn bediene. Damals saß ich ziemlich eingeschüchtert unter lauter Autoren und Autorinnen, die bereits mehrere Werke veröffentlicht hatten und offenbar keinerlei Zweifel im Hinblick auf die Schublade hatten, für die sie schrieben. Mir war der Gedanke, ein bestimmtes „Genre“ zu schreiben eher befremdlich. Die Geschichten, die aus mir herausdrängten, waren weder Krimis noch historische Romane, noch hätte ich sie guten Gewissens als Liebesromane bezeichnen können. Was aber waren sie dann? Und wie würde ich sie einer Agentur anbieten wollen? Wo würden sie in meiner Filiale der großen Buchhandelskette liegen – sollten sie überhaupt je dort landen? Die Frage brannte sich mit perfider Penetranz in meine gerade erst frisch geborene Autorinnenseele.
„Vielleicht schreibst du ja eher E-Literatur?“, fragte mich ein Autorenkollege einige Zeit später, als ich wieder einmal ziemlich erfolglos versuchte, meine Manuskripte schubladengerecht zu beschreiben.
E-Literatur? Also die, die in den Feuilletons und literarischen Magazinen besprochen wurde und deren Verfassern immer so eine Aura von Genialität anhaftet?
„Auf keinen Fall!“, konnte ich überzeugt entgegnen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht genau hätte sagen können, warum ich mir da so sicher war.
Für unser Herz, nicht fürs Regal schreiben wir
Je mehr Romane ich schrieb (und veröffentlichte), je besser ich den Buchmarkt kennenlernte, desto schneller verabschiedeten sich meine Gewissheiten im Hinblick auf die Frage, was einen E-Roman auszeichnet und vom „schnöden“ U unterscheidet. Immer mehr wunderte ich mich über die Selbstverständlichkeit, mit der diese Differenzierung zwischen U- und E-Literatur vorgenommen wird – eine Unterscheidung, die etwa im englischen Sprachraum gar nicht existiert.
Der Frage, was für einen Text wir da überhaupt schreiben und wie wir ihn dann anbieten wollen, müssen wir uns aber früher oder später stellen, möglichst natürlich bereits bei der Planung. Aber seien wir mal ehrlich: Wir treten doch nicht an, um passgenau für ein bestimmtes Ladenregal zu schreiben! Wir schreiben doch – gerade zu Anfang – die Geschichten, die wir im Herzen tragen. Wochen, Monate, manchmal Jahre verbringen wir mit den Geschöpfen unserer beflügelten Fantasie, lassen sie über sich selbst und jegliche Schubladengrenze hinauswachsen – und verzweifeln dann schließlich am Ende dieser großartigen Reise am Exposé. Spätestens dann holt uns die harte Wirklichkeit der Branche wieder ein. Nach den Höhenflügen mit unseren entgrenzten Helden wird von uns verlangt, das Manuskript in ein Genre einzuordnen. Und wenn der mit dem Herzen geschriebene Roman vielleicht irgendwo zwischen den Genres steht – oder sich gar überhaupt keinem Genre zuordnen lässt: Haben wir dann eventuell einen „literarischen“ Roman geschrieben?
Wenn ich Jan Decker, der in der Federwelt eine ganze Reihe zum literarischen Schreiben veröffentlicht hat, glauben kann, dann darf ein „literarischer Roman“ genau diese Genregrenzen überschreiten. Es darf also „literarische“ Krimis geben oder „literarische“ Liebesromane. Nur – woran bemisst sich dieses „Literarische“ denn?
Woran bemisst sich das „Literarische“?
An der Sprache? Aber was genau macht denn die Sprache eines Romans „literarisch“? Besonders schöne, bildhafte Sätze? Oder eher ein minimalistischer Sprachstil? Wie lässt sich beurteilen, ob die Sprache „literarisch“ ist? Mir selbst als Autorin fällt das schwer. Ich bin ja in meiner Wortwelt zu Hause und so fehlt mir naturgemäß der Abstand, um mich selbst sprachlich zu kategorisieren. So wie ich auch die angenehmen oder unangenehmen Gerüche in fremden Wohnungen sofort wahrnehme, die in meiner eigenen aber nicht.
Oder liegt das „Literarische“ an und in den Themen? Muss der Roman politisch sein? Tagesaktuell? Philosophisch? In so vielen Romanen steckt aber doch von all dem etwas – und dennoch sind sie nicht „literarisch“. Mir fällt Maja Lundes Klima-Trilogie ein, die thematisch hochaktuell ist. Aber sind das literarische Romane? Doch wohl nicht, oder doch?
Die Suche nach eindeutigen, einheitlichen Maßstäben
Wenn wir also in Deutschland so schön klar unterscheiden zwischen U und E, sich der gesamte Buchmarkt dieser Kategorisierung unterordnet, die Feuilletons, die Blogs, die Buchhändler*innen, die Verlage genau zu wissen scheinen, wann ein literarischer Text „literarisch“ ist und wann nicht – dann muss es doch eindeutige Maßstäbe geben. Checklisten, die ich abfragen kann, wenn ich als Autorin im Zweifel bin. Was genau ist es, das einen Roman zu einem literarischen Roman macht? Wo verlaufen die Grenzen? Und zuletzt die ganz praktische Frage: Wie schreibe ich ein Exposé, wenn ich meine, einen „literarischen“ Roman geschrieben zu haben? Oder einen Genre-Roman mit literarischen Elementen? Oder einen literarischen Roman mit starken Genre-Elementen?
Im Auftrag der Federwelt bin ich diesen Fragen genauer nachgegangen und habe diejenigen befragt, die sich mit den Kategorien und Schubladen des Buchmarktes ganz sicher auskennen. Vielleicht gibt es sie ja, diese Checkliste, die auch uns Autor*innen helfen würde, unsere Geschichten besser einordnen und passgenauer anbieten zu können ...
U oder E? Eine bewusste Entscheidung, die man vor dem Schreiben treffen muss
Der erste, an den ich mich mit meinem Fragenkatalog gewendet habe, war Martin Brinkmann, Agent und Herausgeber des Literaturmagazins Krachkultur. Martin Brinkmann referierte zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Autorentagung Narrativa 2019 über genau dieses Thema und stimmte mir sofort zu, dass sehr viele Debütautor*innen mit ihren Werken zwischen den Schubladen liegen und aus eben diesem Grunde Absagen erhalten.
Er erklärte mir sogar, dass einer der häufigsten Absagegründe von Verlagen dieser Problematik geschuldet sei: Das angebotene Werk sei für die Literatur nicht literarisch genug, fürs Genre nicht genremäßig genug. Und dann gehöre es leider in gar keinen Markt.
„Das hört sich jetzt so an“, sagte er, „als sei der Markt schuld, als würde nur aus bösem Willen eine Warengruppe (der Nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Roman) weggelassen. Meistens ist es aber so, dass das verkannte Meisterwerk offenbart, dass der Autor oder die Autorin sich noch nicht ausreichend mit der Schreibkunst befasst hat, weder praktisch und vor allem nicht theoretisch.“
Seiner Überzeugung nach ist die zentrale und allererste Entscheidung, die ein Autor, eine Autorin treffen muss eben diese: Schreibe ich U oder E? Und danach erst kämen all die anderen Fragen zu Plot, Perspektive, Wahrnehmung, Formulierung et cetera.
Das mag so einigen das Autor*innenherz in die Hose rutschen lassen, denn mal Hand aufs selbige – wer von uns trifft diese Entscheidung je bewusst und von Anfang an? Wie hätte ich es tun sollen, wenn ich doch gar nicht einmal benennen konnte, was denn „literarisches Schreiben“ so ganz konkret bedeutet?
Der Agent Martin Brinkmann erkennt den literarischen Roman „am eigenen Sound, an einem ureigenen Stil, den ein Autor entwickelt hat“, also an dem, was ihm keiner so schnell nachmachen könne. „Natürlich“, so schränkte er ein, „ist auf diesem Gebiet alles subjektiv, das lässt sich nicht ändern: Der eine mag Hunde, der andere Katzen, wiederum ein anderer hat Pferde noch viel lieber. Daher kann es kommen, dass mir innerhalb von fünf Minuten zwei absolut gegensätzliche Rückmeldungen gegeben werden. Der eine Lektor schäumt vor Wut, dass man ihn mit ‚so was‘ belästigt. Der andere freut sich, ein Angebot abgeben zu dürfen für solch ein originelles Werk deutscher Sprachkunst.“
Eine gesellschaftlich relevante Thematik sei von Vorteil – aber auch hier werde es wieder subjektiv: „So gibt es ja häufig den Vorwurf, ein Autor, eine Figur, eine Generation bespiegele nur sich selbst, aber das könnte man ja genauso gut als zeittypisches Symptom erkennen und seine Schlüsse daraus ziehen.“
Alles subjektiv?
Also alles subjektiv? Vielleicht doch nicht ganz, denn ein klares Kriterium sieht Martin Brinkmann im Sprachlichen. Greift ein Autor in den Setzkasten der Stereotypen und lässt seine Protagonisten alle paar Seiten die Schultern zucken und die Stirne runzeln, hämisch grinsen, künstlich lächeln oder sich diebisch freuen? Oder aber findet er eigene und originelle, nie gehörte, verblüffende Formulierungen zur Beschreibung der Wirklichkeit?
So klar und greifbar dieses Unterscheidungskriterium auch sein mag – ganz zufriedenstellen kann es mich nicht. Denn das Bestreben, eigene Formulierungen zu finden, haben auch sehr viele Genreautor*innen.
Nach Beispielen für gute E-Literatur gefragt, nannte Martin Brinkmann Die untalentierte Lügnerin von Eva Schmidt und Robert Prossers Roman Gemma Habibi. „Saugute“ Unterhaltung ist für ihn zum Beispiel Alma Bayers Wildfutter.
Wichtig: das Verhältnis zwischen Handlung und Sprache
Auch André Hille, Literaturagent und Leiter der Autorenschmiede Textmanufaktur, sieht das wesentliche Unterscheidungskriterium im Sprachlichen beziehungsweise im Verhältnis zwischen Handlung und Sprache. In der Unterhaltung spiele der Plot/die Geschichte eine tragende Rolle. Je literarischer es werde, umso bedeutsamer würden andere Kriterien: Figuren, Sprache, Selbstreflexion über das Medium, Debatten, Metaebenen, Zitate, Metaphorik … Je mehr man in diesen Bereich käme, umso schwieriger werde es, einen Text zu vermitteln, da es dafür nur sehr wenige Programmplätze gäbe, die Beurteilung von literarischer Qualität sehr subjektiv und die Leserschaft sehr klein sei.
Für ihn sehen die Unterscheidungskriterien so aus: „Dient die Sprache klar der Handlung oder bekommt sie einen Eigenwert? Das kann man in der Regel sofort nach wenigen Seiten erkennen. Der neue Roman von Dörte Hansen [Mittagsstunde] zum Beispiel beginnt sehr atmosphärisch, sprachlich dicht, bildhaft; eine Geschichte ist aber auf Seite 50 immer noch nicht zu erkennen.“
Gerade dieses Beispiel zeige, dass die Grenzen zwischen gehobener Unterhaltung und E-Literatur fließend sind und von verlagsstrategischen Überlegungen abhängen. So sei, schreibt Hille, Mittagsstunde weit literarischer, als der Roman vom Verlag verkauft würde. „Gehobene Unterhaltung liegt auf der Grenze und kann in jedem Genre existieren. Die Geschichte steht im Vordergrund, doch wird sie in einer ‚gehobenen‘, aber lesbaren Sprache erzählt.“
Die Krimis von Henning Mankell würde er auch als „gehobene Unterhaltung“ bezeichnen. „Reine“ Hochliteratur wie etwa die von Thomas Bernhard oder Arno Schmidt hingegen finde man nur noch sehr selten. Schon Juli Zeh und Saša Stanišić klassifiziert Hille als „gehobene Unterhaltung mit literarischem Einschlag“.
Den Grenzgängern eine Chance!
Also ist es doch eine willkürlich gezogene Grenze, die allein den Marktmechanismen zuzuschreiben ist?
Es sei kompliziert, gibt Hille zu – und das bestätigt mir auch Julia Eisele, Chefin der Eisele Verlags GmbH, die sich auf die Fahne schreibt, genau den Romanen eine Chance zu geben, die sich auf der Grenze zwischen U und E bewegen und es in der Verlagslandschaft schwer haben.
Woran sie den literarischen Roman erkennt?
„Das ist wohl eine der am schwierigsten zu beantwortenden Fragen überhaupt.“
Ich frage genauer: „An der Sprache? Ist zum Beispiel ein reduzierter Stil ‚literarischer‘ als ein bildhafter Stil? Oder umgekehrt? Oder sind es vielmehr die Themen? Muss es politisch sein? …“
Ja, erfahre ich, in erster Linie mache sie das Literarische an der Sprache fest. „Auch ein bildhafter Stil kann literarisch sein, insofern ist für mich reduziert nicht gleich literarisch. Aber ich denke, wenige überflüssige Worte, treffende Bilder, sprachliche Originalität sind ein Zeichen für Literarizität. Aber Vorsicht: Nicht alles, was verschwurbelt, schwierig zu verstehen ist oder anspruchsvoll klingt, ist deswegen schon literarisch. Letztlich geht es um die Frage: Ist ein Text ‚gut‘? Also: Ist er gut erzählt, emotional packend, sind die Charaktere glaubwürdig, dreidimensional? Gibt es Überraschendes? Klischees sind sicher ein Zeichen von eher weniger guter Literatur. Es muss keinesfalls politisch sein, gesellschaftlich relevant schon eher.“
Wo genau verläuft die Grenze?
Noch schwieriger findet Eisele die Frage zu beantworten, wo die Grenze zwischen einem gehobenen Genre-Roman und einem literarischen Roman verläuft. Die Verlage sähen eindeutige Genres gern. Was man nicht lange erklären müsse, verkaufe sich leichter. „Gehoben“ könne ein Roman zum Beispiel schon dadurch sein, dass er ein „schwieriges“ Thema transportiert. „Und davor haben Verlage in der Regel Angst, denn sie müssen Bücher verkaufen“, stellt sie fest. In ihrer Arbeit als Verlegerin zählt vor allem die Frage nach der Verkäuflichkeit. Der Idealfall sei ein intelligenter, gut geschriebener Text, der zugleich Verkaufspotenzial habe, und dann sei ihr auch das Etikett U oder E egal, das ohnehin einfach ein Marketinginstrument sei. „Ich kann ein und denselben Text als U oder als E verpacken“, erklärt sie mir.
Julia Eisele nennt als Beispiel für den Idealfall eines verkäuflichen Romans, der für U-Leser*innen ebenso gut funktioniere wie für Fans der E-Literatur, Die Farbe von Milch von Nell Leyshon. Dieser Roman habe einen sehr speziellen Erzählton, den man als literarisch bezeichnen könne, der aber durch die spannende Geschichte motiviert sei. „Die Geschichte wird von einer jungen Frau erzählt, die gerade erst schreiben gelernt hat. So etwas kann fürchterlich schiefgehen, aber wenn es gelingt, dann ist es ein Glücksfall für alle – für die U- und E-Leser gleichermaßen.“
Die Unterscheidung von U und E als Problem
Ähnlich wie Julia Eisele formuliert es Zoë Beck, Verlegerin bei CulturBooks und Autorin. Sie hält die Unterscheidung von E und U für problematisch, vor allem, wenn sie darauf hinauslaufe, dass Genre zwangsläufig U ist und im E-Bereich nichts zu suchen hat. „Aus der klassischen Musik kommend kann ich ganz klar sagen: Gute und schlechte Kompositionen gibt es in allen Genres. Und es ist völlig unlogisch, warum etwas, das unterhält, nicht auch Anspruch haben sollte. Gute Unterhaltung ist große Kunst.“
Bei jedem einzelnen Werk komme es darauf an, wie mit Sprache umgegangen werde, wie mit der erzählerischen Form und wie vielschichtig das Erzählte sei. Dabei sei es nahezu egal, worüber geschrieben werde, es müsse weder politisch, philosophisch noch auf sonstige Weise vermeintlich relevant sein. „Es gibt sehr vielfältige Arten der stilistischen Umsetzung, und da können seitenweise Landschaftsbeschreibungen genauso ‚literarisch‘ sein wie reduzierte Sprache, die sich auf Hauptsätze konzentriert. Das Literarische entsteht im Zusammenspiel von Sprache, Form und Inhalt.“
In ihrem Verlag suche sie nach „Autor*innen, die etwas über unsere Welt erzählen und die mit der Art, wie sie es tun, überraschen und begeistern. Damit gelten unsere Sachen wohl als E, wobei wir sie alle auch ziemlich U finden. Im Grunde E wie entertaining und U wie unique, um jetzt alles mal auf den Kopf zu stellen.“
Als Beispiel für einen „literarischen Glücksfall“ führt sie Schläge von der indischstämmigen Autorin Meena Kandasamy an, ein Roman, in dem das Thema Gewalt in der Partnerschaft auf sehr ungewöhnliche Weise dargestellt wird. Die Autorin verarbeitet und bearbeitet literarisch ein Thema, das universell verstanden wird und zugleich sie selbst betrifft. Und der Prozess des Schreibens, die kreative Beschäftigung mit den Ereignissen, führt zu einem Sieg der Kunst über den Täter und die Taten.
Ob E, ob U: egal!
Sebastian Wolter, zum Zeitpunkt unseres Interviews noch bei Voland & Quist, brachte es knapp und plakativ auf den Punkt: „Bei Voland & Quist denken und planen wir nicht in den Kategorien E und U. Wir nehmen ein Buch ins Programm, wenn es uns gefällt. Es muss originell sein, sowohl hinsichtlich des Plots als auch in Sprache und Stil.“
Ganz ähnlich formuliert es Wolfgang Hörner, der Programmverantwortliche von Galiani: „Ich stelle mir ehrlich gesagt nie die Frage, ob ein Text ‚literarisch‘ ist oder nicht. Wenn mich bei einem Text Sprache, erzählerische Mittel, Haltung und/oder Inhalt überraschen, entzücken und verblüffen – und wenn das alles zusammen funktioniert –, dann finde ich den Text interessant. Und nur dann.“
Alle Literatur fange mit einem guten Satz an und höre mit einem guten Satz auf. „Alles, was es eh schon gab, kann nur durch erzählerische Energie oder Inhalte glänzen. Sonst ist es langweilig.“ Er nennt als Beispiel den Vorleser von Bernhard Schlink, der ganz und gar nicht durch einen geschliffenen Sprachstil glänze, „aber im Vorleser passt ja so ein etwas einfacher, fast unbeholfener Ton großartig, macht das Buch noch stimmiger“. Das wichtigste Kriterium ist für ihn: nach einer Seite wissen, wer es geschrieben hat.
Und nun?
Bin ich meiner Frage, was das Literarische an einem literarischen Roman ausmacht, nähergekommen? Eins ist sicher: Originalität ist gefragt, sowohl auf sprachlicher als auch auf formaler Ebene, dazu ein relevantes Thema (wobei Relevanz immer individuell und zeitgebunden ist) und eine Geschichte, die über sich hinausweist. Letztlich aber, das haben mir alle Expertinnen und Experten bestätigt, bleibt es eine subjektive Entscheidung, ob einem Text literarische Qualität zugesprochen wird oder eben nicht. Und damit bestätigt sich mein Gefühl, dass wir es hier mit einer höchst künstlichen Kategorisierung zu tun haben, deren Grenzen sich je nach Mode, Marktlage und verlagspolitischer Entscheidung verschieben.
Ein Roman, der gestern noch als mainstreamige Unterhaltung galt, kann morgen schon in den Kanon der Literatur aufgenommen werden, wie die Romane von Raymond Chandler beweisen.
Wo kommt die Kategorisierung her und was muss nun ins Exposé?
Wie mir Sabine Langohr von der Literaturagentur Keil & Keil erzählt hat, ist die Existenz dieser künstlichen Kategorisierung vermutlich ein Überbleibsel des Geniekults vergangener Jahrhunderte und sie weiche in den Verlagen auch zunehmend auf. Warum? Weil in den großen Publikumsverlagen, die beide Buchmärkte bedienen, U- und E-Lektorate immer öfter zusammenarbeiten. Langohr selbst ist vor allem auf der Suche nach guten Manuskripten. Ob die nun als E oder U verkauft werden, ist ihr herzlich egal. Und auch Autor*innen würde sie immer empfehlen, das zu schreiben, was aus ihnen herausdrängt und nicht danach zu streben, ein vermeintlich höherwertiges Werk zu erschaffen.
Und Hans Peter Roentgen, der bereits unzählige Autor*innen gecoacht hat, rät: „Schreib so, wie du gerne liest. Wer gerne poetisch-literarisch liest, wird keinen hard-boiled Krimi schreiben können. Und wer gerne hard-boiled Actionkrimis liest, sollte keinen literarischen Roman versuchen.“
Bleibt noch die letzte Frage: „Wie sollen angehende Autor*innen ihr Exposé gestalten, wenn sie sich in keiner Genreschublade so richtig wohlfühlen und glauben, einen literarischen Roman verfasst zu haben?“
Auch hier hat Hans Peter Roentgen, Autor von Drei Seiten für ein Exposé, eine klare Empfehlung: „Als ‚literarischen Roman‘ würde ich nichts anbieten, weil das zu unbestimmt ist. Hanser, Diogenes oder Suhrkamp könnte man es gut als ‚Gegenwartsroman‘ anbieten. Oder als ‚Coming of Age‘ (zu Deutsch: Entwicklungsroman). Diogenes und Suhrkamp verlegen ja auch literarische Krimis, da könnte man es als ‚Krimi‘ anbieten. Wenn es einer ist. Oder als Familiengeschichte. Und das ist genau das Problem. Auch E-Literatur zerfällt ja in viele Untergliederungen.“ Der Autor oder die Autorin sollte auf jeden Fall einen möglichst treffenden Begriff wählen, der dem Lektorat oder der Agentur möglichst mehr sagt als „literarischer Roman“.
U und E – mein Fazit
Schreiben ist ein Wagnis, ganz besonders dann, wenn wir uns an Genregrenzen herantasten oder sie gar sprengen. Machen wir uns über Marktmechanismen kundig, so wie wir das Handwerk des Schreibens erlernen, um unser Wissen dann möglichst wieder aus unserem Bewusstsein zu verbannen, damit wir uns nicht von vornherein Fesseln anlegen. Fesseln, die genau das verhindern, was wir brauchen, um einen Verlag zu finden: eine ureigene Stimme, mit der wir Geschichten erzählen, die außer uns so niemand würde erzählen können.
Als ich Die Ewigkeit des Augenblicks schrieb, den Roman, der meine Spurensuche angestoßen hat, war mir bewusst, dass er in keine herkömmliche Schublade passen würde. Also habe ich mir eine eigene Genreschublade geschaffen: den magischen Liebesroman. Klingt doch gut, oder?
Autorin: Stefanie Hohn | www.zeilenraum.de | [email protected]
Weiterlesen in: Federwelt, Heft 148, Juni 2021
Blogbild: Carola Vogt
SIE MÖCHTEN MEHR LESEN?
Dieser Artikel steht in der Federwelt, Heftnr. 148, Juni 2021: /magazin/federwelt/archiv/federwelt-32021
Sie möchten diese Ausgabe erwerben und unsere Arbeit damit unterstützen?
Als Print-Ausgabe oder als PDF? - Beides ist möglich:
Sie haben gerne etwas zum Anfassen, und es macht Ihnen nichts aus, sich zwei, drei Tage zu gedulden?
Dann bestellen Sie das Heft hier: /magazine/magazine-bestellen
Bitte geben Sie bei »Federwelt-Heft-Nummer« »148« ein.
Download als PDF zum Preis von 4,99 Euro bei:
- beam: https://www.beam-shop.de/sachbuch/literaturwissenschaft/689233/federwelt-148-03-2021-juni-2021
- umbreit: https://umbreit.e-bookshelf.de/federwelt-148-03-2021-juni-2021-16801396.html
- buecher: https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/federwelt-148-03-2021-juni-2021-ebook-pdf/eschbach-andreas-warner-anna-kathrin-zipperling-jasmin-koelpin-regine-dibbern-julia-hohn-stefanie-warsoenke-annette-seven-karin-weber-martina-rossi-michael-stronk-cally/products_products/detail/prod_id/61998474/
- amazon: https://www.amazon.de/Federwelt-148-03-2021-Juni-2021-ebook/dp/B0969NZ71C/
Oder in vielen anderen E-Book-Shops.
Suchen Sie einfach mit der ISBN 9783967460162.

