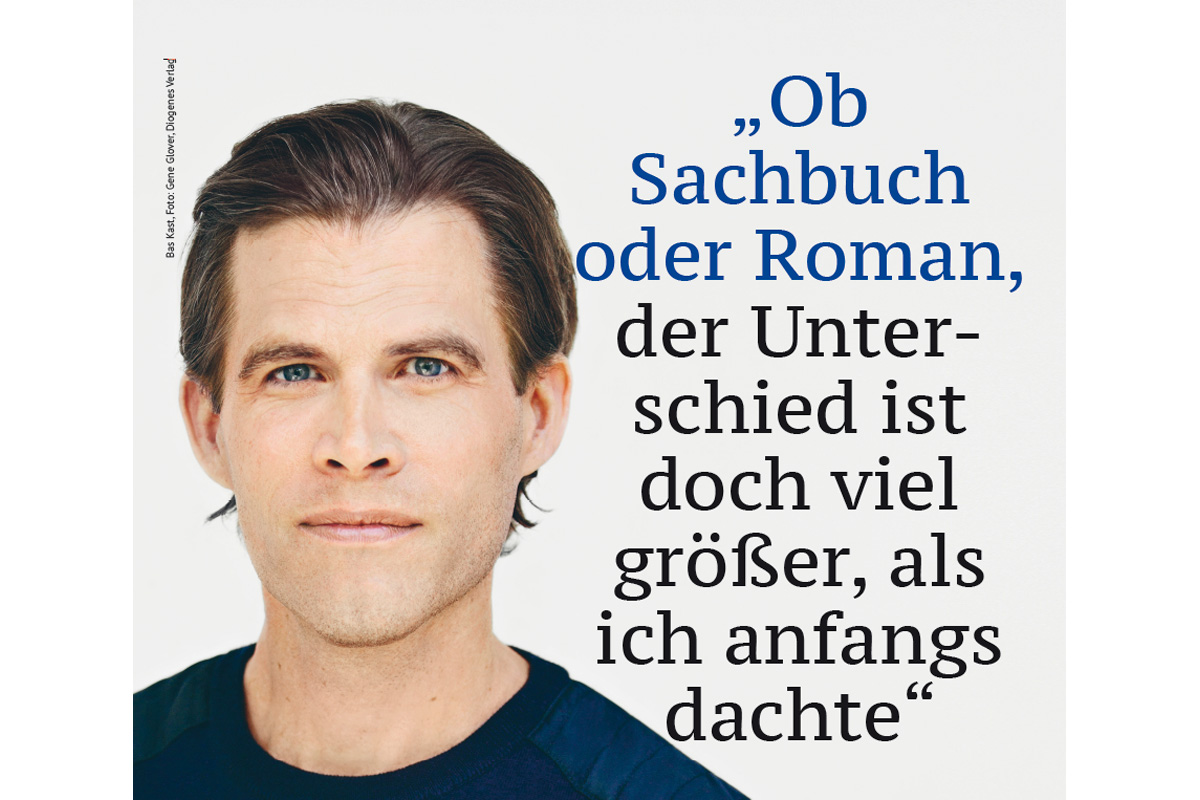
Bas Kast ist Wissenschaftsjournalist und etablierter Sachbuchautor. Sein Buch Der Ernährungskompass, das 2018 bei C. Bertelsmann erschien, verkaufte sich über eine Million Mal, ist ein Weltbestseller. Dass die Gala Bas Kast sogar als „Ernährungsguru“ bezeichnete, ist ihm eher unangenehm. Weil er weder Arzt noch Ernährungsfachmann ist, sondern eben Autor, der, im Ernährungskompass-Fall, tausende Studien durchgearbeitet und daraus die zwölf wichtigsten Ernährungsregeln abgeleitet hat. Im September 2020 erschien mit Das Buch eines Sommers: Werde, der du bist sein literarisches Debüt. Warum hat er nicht auf den nächsten, so gut wie sicheren Sachbuch-Erfolg gesetzt? Was hat ihm beim Schreiben die meisten Schwierigkeiten bereitet, und wie hat er diese gelöst? Das und mehr hat er Anke Gasch „mal eben“ vor dem Kind-aus-dem-Kindergarten-Abholen erzählt. Einer der ersten Sätze, die er im kurzen Vorgespräch zum Interview sagte, lautete: „Ob Sachbuch oder Roman – der Unterschied ist doch viel größer, als ich anfangs dachte.“
Herr Kast, war es von Anfang an der Plan, dass Ihr nächstes Buch ein Roman wird oder wie ist es dazu gekommen?
Viele halten mich für einen Ernährungsberater, der ich nicht bin, und dieses falsche Bild hat mich zunehmend genervt. Ich verstehe mich als Autor, ich wollte schon als 16-Jähriger Romancier werden. Meine Frau meinte, ich sollte als nächstes Buch etwas über Erziehung schreiben, wir haben drei kleine Söhne. Dazu habe ich dann viel recherchiert und nachgedacht. Mehr und mehr bekam ich dabei das Gefühl, dass ein Ratgeber nicht das Richtige wäre. Ich ging in mich und fand: Das Wichtigste im Leben ist doch, dass ein Kind der Mensch wird, der es im Kern seines Wesens ist. Darüber wollte ich eine Geschichte schreiben, mit einer Hauptfigur, die zu ihrem wahren Kern findet. Das war die Geburtsstunde für meinen Roman.
Wie ging es dann weiter?
Letztes Jahr im April hatte ich die Idee und habe sofort angefangen zu schreiben. So hatte ich schnell viel Stoff. Es gab aus meiner Sicht zwei Teile: eine Familiengeschichte und eine Art „Sachteil“, verpackt in einen Dialog, der dazu führt, dass die Hauptfigur in sich geht und zu sich selbst findet, was wiederum die Familiengeschichte ändert. Den Sachteil zu schreiben fiel mir relativ leicht. Schwierig war die Familiengeschichte. Sie stellte mich vor die Frage: Was heißt es eigentlich, dass ein Text literarisch ist? Was macht den Unterschied zum Sachbuch aus?
Und wie haben Sie diese Frage für sich beantwortet?
Meine Frau hat mir sehr geholfen. Ich habe zwar selbst oft bemerkt, wenn eine Szene nicht dynamisch war. Nur was dann tun? Bei einer solchen Szene gab mir meine Frau folgendes Feedback: „Ich sehe nichts und fühle nichts!“ Beim Schreiben hatte ich zudem oft den Satz vom ehemaligen C. Bertelsmann-Chef im Ohr: „Sachbuchautoren können keine Romane.“ Obwohl mich das letztlich auch motiviert hat. Ich dachte mir: Nun, wir werden sehen!
Also ließ ich nicht locker, und irgendwann ist mir klar geworden: Als Romanautor transportierst du in erster Linie Emotionen und nicht Informationen. Meine Frau hat mich dann wirklich Stufe für Stufe weitergebracht, einfach, indem ich ihr immer meine Entwürfe zeigte, und sie diese mir mit ihrem Eindruck versehen zurückgab. Später hat sie zum Beispiel gesagt: „Schon besser, und jetzt will ich mehr über Nicolas [das ist die Hauptfigur] wissen.“ Und viel später dann: „Jetzt könntest du langsam mal an die Sprache rangehen, sie eine Spur eleganter machen.“
Für mich war diese Rohfassung ein Kampf. Damit bin ich dann mit Herzklopfen auf Diogenes zugegangen, natürlich, ohne ihnen etwas von der Mühe oder dem Kampf zu verraten …
Sie arbeiten ohne Literaturagentur?
In diesem Fall ja.
Warum Diogenes? Und wie haben Sie sich und Ihr Projekt dann dort vorgestellt?
Ich fand Diogenes schon immer den allercoolsten Belletristik-Verlag. Innerlich habe ich dem ganzen Projekt eine etwa 30-prozentige Erfolgs-Chance gegeben. Meine Mail landete bei Ursula Bergenthal, der Programmleiterin, die zu meiner großen Überraschung sofort sehr begeistert war. Einige Wochen später saß ich dann in Zürich im Verlag und sagte: „Bitte, falls dies für Sie in Frage kommt, geben Sie mir keinen Vorschuss, geben Sie mir einen Romankurs!“
Haben Sie den Kurs bekommen?
Etwas noch viel Besseres! Mir wurde die Lektorin Anna von Planta zur Seite gestellt, Lektorin von Dürrenmatt, John Irving und Paulo Coelho. Natürlich bekam ich auch einen Vorschuss.
Mit dem Feedback Ihrer Lektorin haben Sie den Roman dann weiterentwickelt?
Das kann man wohl sagen. Die Umarbeitungen waren tiefgreifend. All diese Sachen, die ich nicht gewusst habe ... Die Arbeit mit Anna von Planta gehört zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens. Die größte Herausforderung für mich war, so etwas wie Empathie für die Figuren zu entwickeln. Ich glaube, ich kann relativ gut mit Kritik umgehen, wenn ich merke, das bringt mich weiter. Ich bin sogar sehr dankbar dafür. Ich kenne allerdings auch Kollegen, die damit nicht so gut zurechtkommen. Man sollte hier ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und nicht gleich defensiv reagieren.
Und welche Kritik kam?
Ähnliche wie die von meiner Frau. Als meine Lektorin und ich uns auf der Frankfurter Buchmesse trafen, um das Manuskript zu besprechen, nahm sie mich zur Seite und sagte: „Herr Kast, Sie müssen weniger denken und mehr fühlen!“ Anna von Planta ist zum Glück sehr anspruchsvoll. Und ich war durchaus nicht immer sicher, ob ich ihrem hohen Anspruch würde gerecht werden können. Ich hatte wirklich meine Zweifel, ob ich es letztlich hinbekomme. Einmal sagte sie: „Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde einfach so lange Fragen stellen, bis das Manuskript da ist, wo Sie es haben wollen.“ Nach einer weiteren Überarbeitung (ich hatte schon einen guten Eindruck vom Text), sagte sie: „Jetzt sollten Sie vielleicht noch einmal alle Figuren überdenken.“
Im Sachbuch gibt es natürlich keine Figuren ohne realen Hintergrund ...
Ja, daher hatte ich es mir mit den Figuren so einfach wie möglich gemacht: Vorlage für die wichtigsten sind meine Frau, mein ältester Sohn und ich. Trotzdem musste ich dann noch mal in die Tiefe gehen, und auch da hat meine Frau mir geholfen, etwa was kleine, farbige Details betrifft. Sie hat zum Beispiel eine Modenschau für mich veranstaltet: „Schau mal, das würde ich tragen, wenn ich im Flugzeug sitze ...“ Und so trägt also meine Frauenfigur im Buch auf der Flugreise hin zu jener Villa, in der die Geschichte letztlich spielt, ein ganz bestimmtes schwarzes Kleid.
Oder meine Lektorin sagte: „Herr Kast, ich sehe nicht genau, wie diese Villa aussieht.“ Sie hatte recht. Meine Beschreibungen waren nicht konsistent. Auch darüber habe ich mit meiner Frau Sina geredet. Sie ist vielseitig begabt und hat mir ein dreidimensionales Papiermodell der Villa gebastelt, sodass ich beim Schreiben immer sehen konnte, wo meine Figuren stehen und was sie dabei sehen.
Damit wären wir beim Stichwort „Recherche“ und dem Unterschied zur Arbeit am Sachbuch ...
Aber hier gibt es vielleicht doch eine grundsätzliche Gemeinsamkeit: In beiden Fällen muss ich als Autor zehnmal mehr wissen, als ich aufschreibe. Diesen Aspekt der „Hintergrundrecherche“ habe ich beim Roman zuerst auf die leichte Schulter genommen. Man kommt aber nicht darum herum: Du musst auch beim Roman deinen Hintergrundstoff in- und auswendig kennen, also die Figuren, die Landschaft oder Räumlichkeiten, wo die Geschichte spielt. Du musst wissen, wie alles und alle aussehen, in welchem Verhältnis die Figuren zueinander stehen, welche Geschichte sie haben et cetera. Wenn einmal klar ist: So tickt meine Figur, diese Verletzungen hat sie, dann ist auch klar, dass sie in einer bestimmten Situation so und so reagieren würde. Ich muss als Autor nicht mehr bewusst darauf achten, ob alles stimmig ist. Es wird „automatisch“ stimmig, weil es so aus der Figur herauskommt.
Was hat Ihnen beim Schreiben am meisten Schwierigkeiten bereitet?
Der Anfang saß lange nicht, und ich hatte keine Ahnung, wie ich das ändern sollte. Ich habe das Manuskript dann ein paar Wochen liegen lassen. In diese Zeit fiel die Geburt unseres dritten Sohnes. Wie man das halt so tut, habe ich ihn viel rumgetragen, von November bis nach Weihnachten, mit Kopfhörern auf, Musik hörend, mit dem Wissen, wie die Figuren sind, wie sie sich entwickeln. Während ich das tat, habe ich nicht am Text gearbeitet, kein Stück, nur nachgedacht, fantasiert. Und dann, im Januar, habe ich mich hingesetzt und die ersten zwanzig Seiten in ein paar Tagen komplett neu geschrieben. So, dass auch ich das Gefühl hatte: Jetzt ist es gut. Ich schickte Anna von Planta den neuen Entwurf, und ich werde nie vergessen, was sie mir zurückschrieb (sie spricht aus Spaß gern mal Englisch): „A fiction writer is born!“ Bei unserem Telefonat rief sie dann als Erstes ins Telefon: „What happened?“ Es war herrlich!
Mehr Emotionen, bitte!
Ein Tipp von Bas Kast für Kolleg*innen, die auch mehr Gefühl in ihre Geschichten bringen wollen
Ich denke, es hilft sehr zu wissen, wohin deine Geschichte geht. Es hilft, einen Endpunkt zu haben, auf den man hinschreibt. Dies gilt im Grunde für jede Szene: Was ist die Anfangs-Emotion der Szene und was die End-Emotion? Wenn sich nichts geändert hat, ist die Szene statisch. Aber wenn du dich von Liebeskummer zu Zuversicht bewegst, hast du Dynamik, oder von Angst zu noch mehr Angst.
Klingt, als ob der Anfangs-Stoff in Ihnen gewachsen ist, bis er papiergeburtsreif war ... Können Sie für unsere Leser*innen schildern, was Ihnen geholfen hat, zu dem neuen, starken Anfang zu kommen?
Tja, schwer zu sagen. Ich habe versucht, mehr aus dem Gefühl zu schreiben. Ich wollte von einem Gefühl der Niedergeschlagenheit zu Hoffnung gehen. Ich wollte eine Aufbruchsstimmung erschaffen. Ich wollte schildern, dass einem das Leben in manchen Situationen desolat erscheinen mag, doch dann, plötzlich, unerwartet, nimmt es doch noch eine positive Wendung. Ich wusste: Das will ich zu Papier bringen. Diese Stimmung. Es war direkt aus dem Herzen geschrieben, wirklich pur aus dem Gefühl heraus. Ich wünschte, ich könnte es reproduzieren. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das bewerkstelligen soll, denn es war, als schriebe „es“ aus mir heraus. Als schriebe nicht mein bewusstes Ich, sondern meine Seele.
Im Vergleich: Der erste Entwurf vom Anfang und der Anfang im Buch
Die erste Fassung der ersten Zeilen aus Das Buch eines Sommers: Werde, der du bist:
Eigentlich hatte ich für den Tod meines Onkels keine Zeit, ich befand mich in einem Meeting. Mit dem Handy am Ohr blickte ich zu Michael rüber, meinem Stellvertreter, der gleich neben mir saß und der so groß war, dass man ihn hätte halbieren können, und er hätte immer noch etwas Einschüchterndes gehabt. Ich stand auf, ein Dutzend Augen auf mich gerichtet, die mich verfolgten, ich murmelte ein kurzes „Entschuldigung“ in die Runde und verließ – in der linken Hand mein Handy, in der rechten ein Strategiepapier, das meine Hand sinnloserweise mitnahm – den gläsernen Konferenzraum.
[So etwas passiert vielen von uns beim ersten Entwurf, erst bei der Überarbeitung fällt auf: Augen können einen nicht verfolgen, außer vielleicht, man schreibt im Horror-Genre.]
„Valerie, ich bin ein bisschen im Stress, könntest du dich vielleicht darum kümmern?“
„Ich mich darum kümmern? Nicolas, das war dein Onkel Valentin …“
Pause.
„Ich kann es immer noch nicht glauben.“
Meine Beine waren steif geworden vom Sitzen, ich spürte meine Kniegelenke, die Sehnen an den äußeren Seiten der Knie, und ging ein paar Schritte durch den Flur, ein karger, aschgrauer Schlauch mit langgezogener Glasfront, der mich immer an eine Gangway erinnerte (als könnte man jederzeit in den Flieger steigen und sich den Zumutungen hier entziehen). Ich mochte dieses schnörkellose, fast aseptische Ambiente.Die finale Fassung:
Ich weiß noch, wie mir vor vielen Jahren der Sommer meines Lebens bevorstand. Oder doch eigentlich hätte bevorstehen müssen. Das Abitur in der Tasche, das Studium noch in weiter Ferne, hätte jenes ultimative Abenteuer namens Leben endlich losgehen können. In meiner grenzenlosen Freiheit musste ich nur noch zugreifen, ich musste mich bloß noch hineinfallen lassen und es in vollen Zügen genießen.
Nur fühlte ich mich überhaupt nicht frei, und das Abenteuer entfernte sich Minute für Minute mehr von mir, mit rasender Geschwindigkeit. Um genau zu sein, saß es in einer Boeing 747, auf dem Weg nach Sydney. Das Abenteuer, das schulterlanges, kastanienbraun glänzendes Haar hatte und Katharina hieß, wollte mich nicht. Es wollte, statt bei mir zu bleiben, am anderen Ende der Welt, in Australien, studieren.
Gibt es auch etwas, das Ihnen bei der Arbeit an Das Buch eines Sommers: Werde, der du bist ganz besondere Freude bereitet hat?
Mir macht der ganze Prozess des Schreibens Spaß, am meisten aber das „Kneten des Rohmaterials“: Also, du hast schon Text, aber der ist noch nicht perfekt, noch nicht wirklich schön. Es ist fast ein bisschen wie Übersetzen, man übersetzt die Sprache von einer hässlichen oder trivialen oder schnöden Erstfassung in eine nach und nach elegantere. Zum Beispiel beim Satz im folgenden Kasten: Der Satz mit dem Winter war erst gar nicht da. Dann überlegte ich mir was mit „Winter in mir und Sommer in ihm (dem Onkel)“. Danach kam ich auf die Idee, dass der Sommer im Onkel so groß sein könnte, dass er den Winter in Nicolas und dessen eisige Luft aufzunehmen vermag. Und dass dann noch genügend Wärme für beide übrig bleiben würde das kam zum Schluss noch hinzu …
Mein poetischster Satz
Von Bas KastEr war der Einzige, der nicht mit Sprüchen kam von wegen „Kopf hoch“ und „Das wird schon wieder“ und was weiß ich. Als wäre er der Einzige, der keine Angst vor meinem Schmerz hatte. Als wäre der Sommer in ihm so groß, dass er den Winter, den ich mit mir herumschleppte und dessen eisige Luft ich nach allen Seiten hin verströmte, in sich aufnehmen könnte, und es würde immer noch genügend Wärme für uns beide übrig bleiben.
Autorin: Anke Gasch | www.anke-gasch.com | [email protected]
Weiterlesen in: Federwelt, Heft 145, Dezember 2020
Blogbild: Gene Glover / © Diogenes Verlag
SIE MÖCHTEN MEHR LESEN?
Dieser Artikel steht in der Federwelt, Heftnr. 145, Dezember 2020: /magazin/federwelt/archiv/federwelt-42020
Sie möchten diese Ausgabe erwerben und unsere Arbeit damit unterstützen?
Als Print-Ausgabe oder als PDF? - Beides ist möglich:
Sie haben gerne etwas zum Anfassen, und es macht Ihnen nichts aus, sich zwei, drei Tage zu gedulden?
Dann bestellen Sie das Heft hier: /magazine/magazine-bestellen
Bitte geben Sie bei »Federwelt-Heft-Nummer« »145« ein.
Download als PDF zum Preis von 4,99 Euro bei:
- beam: https://www.beam-shop.de/sachbuch/literaturwissenschaft/658361/federwelt-145-06-2020-dezember-2020
- umbreit: https://umbreit.e-bookshelf.de/federwelt-145-06-2020-dezember-2020-15325233.html
- buecher: https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/federwelt-145-06-2020-dezember-2020-ebook-pdf/kast-bas-vorpahl-elias-wildner-guenther-weiss-anne-lausen-bettina-seidl-leonhard-f--rossi-michael-hillebrand-diana/products_products/detail/prod_id/60677656/
- amazon: https://www.amazon.de/Federwelt-145-06-2020-Dezember-2020-ebook/dp/B08PBYQY1M
Oder in vielen anderen E-Book-Shops.
Suchen Sie einfach mit der ISBN 9783967460117.

